VolkswagenStiftung fördert UHH-ProjekteWie beeinflussen Medien die Polarisierung in europäischen Gesellschaften?
6. Februar 2025, von Newsroom-Redaktion
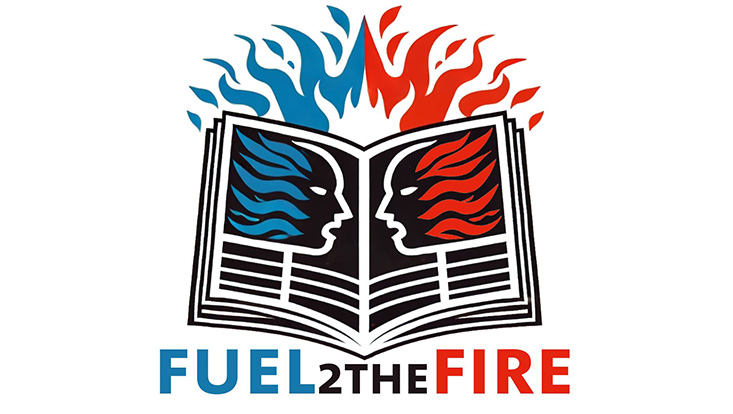
Foto: Meyer/Pröschel
Auch etablierte Demokratien wie Deutschland sind zunehmend durch die Polarisierung der Gesellschaft und die damit einhergehenden Auseinandersetzungen gefährdet. Welche Rolle die Medienberichterstattung bei diesem Prozess spielt, untersuchen zwei Forschungsprojekte der Professur für Klimakommunikation an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Unter dem Kurztitel „Fuel2theFire“ geht es um die Frage, wie Medienberichterstattung zur Polarisierung von Debatten beiträgt und was der Journalismus tun könnte, um konstruktive Auseinandersetzungen zu fördern. Bereits das Pilotpojekt „Political Polarization and Journalistic Practices: Adding Fuel to the Fire?“ wurde von der VolkswagenStiftung gefördert. Das Hauptprojekt „Media and Polarization in Europe: How Journalism can Support Democratic Debates“ erhält für die kommenden drei Jahre circa eine Million Euro und ist eines von elf bewilligten Kooperationsprojekten der aktuellen Ausschreibung.
Ziel des Gesamtprojekts, das im Rahmen der Förderinitiative „Transformationswissen über Demokratien im Wandel“ läuft, ist es, die Zusammenhänge zwischen journalistischen Praktiken, der Polarisierung von Debatten und der Polarisierung in den Köpfen der Mediennutzenden zu untersuchen. „Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten wollen wir Empfehlungen für Redaktionen erarbeiten, die einerseits evidenzbasiert und andererseits in der Praxis umsetzbar sind“, so Projektleiter Michael Brüggemann, der die Professur für Kommunikationswissenschaft, Klima- und Wissenschaftskommunikation an der Universität Hamburg innehat.
Untersuchung von Inhalten und Wirkung
Neben Michael Brüggemann wird das Projekt von Anamaria Dutceac Segesten von der Lund University, Thomas Schnedler von „Netzwerk Recherche“ und Mike Farjam, dem Koordinator des Projekts an der Universität Hamburg, geleitet. Zudem sind Forschende der Universitäten Barcelona und Posen beteiligt. In allen vertretenen Ländern werden Inhaltsanalysen von Medienbeiträgen, Experimente zur Medienwirkung sowie Workshops und Fokusgruppen-Gespräche mit Medienschaffenden durchgeführt.
So wollen die Forschenden umfassend untersuchen, wie europäische Redaktionen über polarisierende Themen und die Polarisierung selbst berichten. Zudem geht es um die Auswirkungen, die diese Berichterstattung darauf hat, wie die Leserschaft die Polarisierung wahrnimmt. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Partnerinnen und Partnern aus der Praxis können gemeinsam Ideen und Lösungen für einen Journalismus, der die Polarisierung nicht unnötig befeuert, entwickelt werden.
Fokus auf Lösungen und Dialog
Erste Ergebnisse aus dem schon angelaufenen Pilotprojekt sind in die gerade publizierten „Hamburger Impulse zur Depolarisierung medialer Debatten“ eingegangen, an denen ein Team von Forschenden anderthalb Jahre gearbeitet hat. Die Autorinnen und Autoren formulieren hier bereits erste konkrete Empfehlungen für die journalistische Arbeit sowie die Moderation von Debatten auf Social Media. Um politische Entscheidungsfindung kritisch und konstruktiv zu begleiten, solle etwa die Lösungssuche begleitet werden, statt sich auf das Konfliktpotenzial zu fokussieren. Auch ein über die Berichterstattung hinausgehender Dialog mit dem Publikum sei hilfreich, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.


