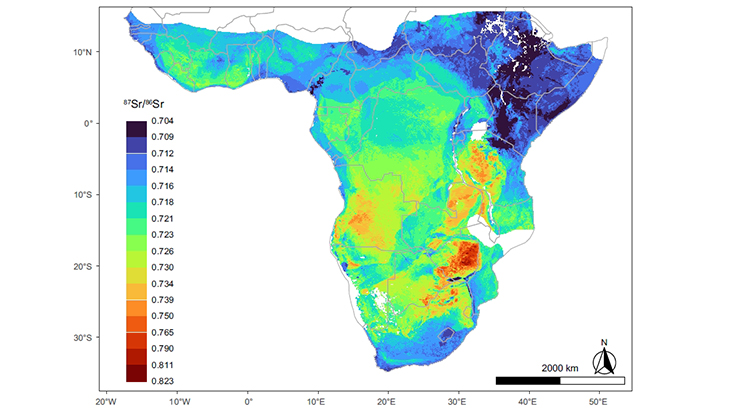Was war, was ist, was wirdTeam der Archäologie forscht in Verbundprojekt zur Stärkung des ländlichen Raumes
23. März 2018, von Anna Priebe
Laut einer Studie des „Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung“ von 2011 haben zwei Drittel aller ländlichen Gemeinden Deutschlands zwischen 2003 und 2008 mehr als ein Prozent ihrer Bevölkerung eingebüßt. Wie lässt sich dieser Trend aufhalten? Und was macht eine Region lebenswert? Im Verbundprojekt „Regiobranding“ sollen für drei Fokusregionen in der Metropolregion Hamburg besondere Charakteristika sowie Ideen für deren Nutzung entwickelt werden. Auch ein Team aus dem Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Hamburg ist beteiligt.
Landschaftsplanungs-Prozesse sind Dr. Frank Andraschko zufolge für Archäologen wie ihn eher frustrierend: „Wir werden konsultiert, wenn die Planungen durch sind und die Autobahn gebaut wird. Dann kommen wir und retten, was zu retten ist.“ Beim Verbundprojekt „Regiobranding“ (2014–2019), das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, ist das anders. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg waren von Anfang an dabei.
„Im Großen geht es um nachhaltiges Landmanagement und darum, ländliche Regionen zu stärken“, erklärt Andraschko, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie. Insgesamt acht Partnereinrichtungen aus Wissenschaft, Kommunalverwaltung und Praxis – neben der Universität Hamburg unter anderem die Leibniz Universität Hannover, die die Projektleitung innehat, das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung und das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein – untersuchen gemeinsam, was eine Region für die Menschen vor Ort lebenswert macht und wie man diese Identität nutzen und bewahren kann. „Da spielen Qualitäten wie eine schöne Landschaft und gute Luft eine Rolle, aber auch die Infrastruktur: Habe ich einen Arzt in der Nähe, wie ist die Anbindung zur nächsten Stadt und habe ich eine vernünftige Schule“, so Andraschko. In drei Phasen bearbeiteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Fragestellungen aus ihren jeweiligen Fachgebieten.
Was ist der Bevölkerung wichtig?
Während etwa die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Architektur in der ersten Phase (Wissenserhebung) das Phänomen „ländliches Wohnen“ untersuchten und Fragen nachgingen, wie „Wie war es früher?“, „Wo kann es hingehen?“ und „Wie können leerstehende Gebäude umgenutzt werden?“ setzte das Team aus der Hamburger Archäologie den Fokus auf die Kulturlandschaft. „Wir sind mitten in einer Kulturlandschaft, das heißt, sie wurde über sechs- bis siebentausend Jahre von Menschen geformt“, erzählt Andraschko. Von der Verwaltung und den Leuten vor Ort werde das aber oft gar nicht so wahrgenommen.
Für die drei Fokusregionen des Projektes – Steinburg, Lübeck-Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Elbe-Wendland – wurden daher Kulturdenkmäler, zum Beispiel Grabmäler oder markante Gebäude, identifiziert, um dann mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen: „Wir haben untersucht, wie diese archäologischen Denkmäler wahrgenommen werden und ob den Leuten das, was sie vor der Haustür haben, überhaupt bekannt ist.“ Damit zusammen hing dann natürlich die Frage, wie wichtig die Denkmäler für die Menschen sind.
Neben Tagungen auf Verwaltungsebene fanden dafür zahlreiche Workshops vor Ort statt, „mit Leuten von dort, mit dem Heimatverein“, wobei besonders die richtige Ansprache eine Herausforderung war: „Wenn wir unser Anliegen bei denen nicht rüberbringen können, bringt das alles nichts.“ 60 bis 100 Leuten nahmen pro Veranstaltung teil.
Kulturlandschaft im Wandel
Entstanden ist so in der zweiten Projektphase (Entwicklung der Branding-Konzepte) zum Beispiel die „ Kulturlandschaftswandelkarte Steinburger Elbmarschen“. In der Broschüre wird unter anderem die Landnutzung der Region in vier zeitlichen Phasen (1796, 1878, 1925, 2015) dargestellt und gezeigt, wie sie sich verändert hat. Auch spezielle Bereiche wie Wassernutzung, Überschwemmungsprävention und Windenenergie werden im historischen Querschnitt beleuchtet. Ergänzend wurden die Einheimischen zudem nach ihrem Lieblingsort gefragt: „Wo bin ich gerne? Wo gucke ich gerne hin? Wir haben die Leute gebeten, diese Orte mit kleinen Fähnchen auf einer Landkarte zu markieren“, berichtet Andraschko. So hätten sich schnell bestimmte Punkte herauskristallisiert, die „stark einheimisch geprägt sind“.
Die Wandelkarte ist eines der Instrumente, die in der dritten Phase (Modellhafte Umsetzung und Evaluierung der Konzepte) erprobt und im besten Fall dauerhaft implementiert werden sollen. Sie kann beispielweise vom Denkmalschutz und der Verkehrsplanung, aber auch vom Tourismus genutzt werden. „Das sind kleine Werkzeuge, mit denen alle arbeiten können, aus denen sie etwas ziehen können und die wir als gemeinsame Basis nehmen können“, fasst Andraschko zusammen. Wie es konkret weitergeht, entscheiden dabei die Landkreise vor Ort. Die Kulturlandschaftswandelkarten können u. a. bei zukünftigen öffentlichen Planungsverfahren helfen, Entwicklungen unter Wahrung der regionalen Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale zu gestalten. Im Kreis Steinburg ist zum Beispiel vorgesehen, die Daten in das webbasierte Geoinformationssystem des Kreises einzustellen und sie damit in größerem Umfang den Kommunen für ihre Bauleitplanung zugänglich zu machen.
Dr. Frank Andraschko zieht auch persönlich ein positives Fazit: „Ich finde die Zukunftsorientierung sehr schön. Wir kommen ja doch eher aus der Geschichte und können den Leuten erzählen, was gewesen ist und warum, aber es ist toll, auch mal etwas zur Zukunft beizutragen.“