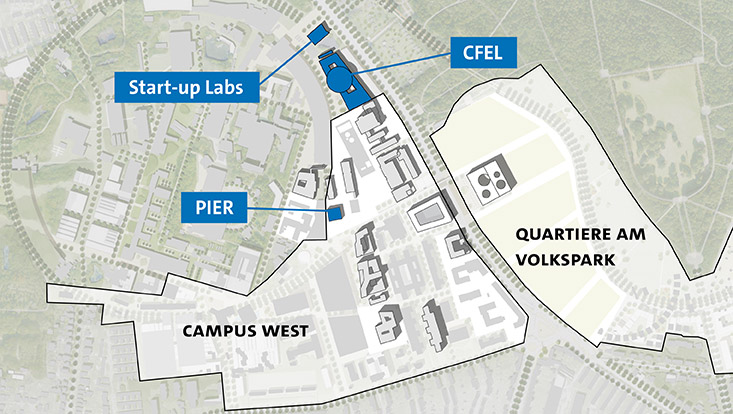Sondereinheit „Tollensetal“Forschungsprojekt analysiert Verletzungsspuren aus der Bronzezeit
5. März 2018, von Anna Priebe
Mehr als 12.000 Menschenknochen aus der Bronzezeit wurden im Tollensetal bei Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden – viele von ihnen weisen Verletzungsspuren von Kämpfen auf. Welche Waffen wurden dabei verwendet? Und wie wurde gekämpft? Zwei Wissenschaftlerinnen haben an der Universität Hamburg einen Prozess entwickelt, um diese Fragen noch genauer als bisher beantworten zu können. In einem Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit rund 200.000 Euro gefördert wird, werden die Methoden nun optimiert.
Es sieht so aus, wie man es aus den Fernseh-Serien kennt: Auf dem Computerbildschirm liegt ein in Umrissen animierter Mensch auf dem Boden, leicht gekrümmt, sein rechtes Bein ist angewinkelt. Mit einem Klick lässt Hella Harten-Buga eine Lanze in seinen Oberschenkel stoßen und demonstriert, wie genau diese Lanze wohl herausgezogen worden sein muss, um den Bruch des Oberschenkelknochens zu erzeugen, der auf einem Foto in der Ecke des Bildschirms zu sehen ist.
Was nicht ist wie im Fernsehen: Der dargestellte Mann ist nicht 2018 in Miami ums Leben gekommen, sondern in der Bronzezeit (ca. 2.000 – 700 v. Chr.), in einem Flusstal in Mecklenburg-Vorpommern. Und Hella Harten-Buga ist nicht bei der Kriminalpolizei, sondern wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem DFG-geförderten Forschungsprojekt. Gemeinsam mit Melanie Schwinning hat sie während ihres Masterstudiums der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie an der Universität Hamburg einen neuen methodischen Prozess entwickelt, um Verletzungen an Knochen, die bisher etwa durch experimental-archäologische Schussversuche und Vergleiche untersucht wurden, noch besser analysieren zu können.
Erster Nachweis kriegerischer Auseinandersetzungen nördlich der Alpen
Mehr als 12.000 Menschenknochen wurden im Tollensetal gefunden – zusammen mit Waffenspitzen, Dolchen und Schwertern sowie Tierknochen –, rund 100 weisen sogenannte perimortale Verletzungen auf, die also um den Todeszeitpunkt herum zugefügt worden sein müssen. „Die Funde stammen etwa aus dem 12. Jahrhundert vor Christus“, erklärt Prof. Dr. Frank Nikulka, der das Projekt gemeinsam mit PD Dr. Jörg Orschiedt von der Freien Universität Berlin leitet. Und sie sind eine Besonderheit, denn „es handelt sich hier um die ältesten Hinweise auf schlachtenähnliche, kriegerische Auseinandersetzungen nördlich der Alpen“, so Harten-Buga, „also den Beginn dessen, was wir heute als Krieg bezeichnen.“ Auch, wenn man laut Frank Nikulka die modernen Vorstellungen von „Schlachtfeld“ und „Armee“ relativieren müsse, „denn wie groß die Gruppen waren, die sich dort gewaltsam auseinandergesetzt haben, wissen wir faktisch noch nicht“.
Von 2010 bis 2016 wurden die Funde erstmals untersucht. Die Archäologie in Hamburg war seit 2012 mit einem kleinen Teilprojekt beteiligt, das nun zu einem eigenen Großprojekt geworden ist. Harten-Buga hat vor ihrem Master bereits ein Architekturstudium abgeschlossen; sie ist für die erste Phase des neu entwickelten Prozesses zuständig: „Kurz gesagt entwickele ich basierend auf digitalen Bildanalysen von 3D-Modellen aus CT-Aufnahmen und der Digitalmikroskopie eine Hypothese darüber, welche Waffen verwendet wurden.“ War die Waffe aus Stein oder Bronze? War es ein Nah- oder Fernkampf? All diese Informationen sind wichtig, um auf Art und Motivation der Auseinandersetzung schließen zu können. „Mit den Bildgebungsverfahren bekommen wir sehr hochaufgelöste Ansichten von Verletzungsspuren, können 3D-Profile erstellen und digital Verletzung und mögliche Waffen abgleichen.“ Am Ende entsteht so eine erste Hypothese zu Waffenart, Material und möglichem Eintrittswinkel.
Rechnerisch Knochen kaputtschießen
Diese Randbedingungen benötigt Melanie Schwinning, um mit einer sogenannten Finite-Elemente-Analyse (FEA) die Hypothese zu verifizieren. „Es ist eine Methode für die numerische, sprich mathematische Simulation von mechanischen Vorgängen“, erklärt die Archäologin, die vorher als Flugzeugingenieurin gearbeitet hat. „Es geht darum, wie und wo welche Kräfte wirken. Am Computer wird das Modell eines gesunden Knochens erstellt – und ich schieße den rechnerisch unter unseren Randbedingungen kaputt.“ Dadurch kann sie die vorliegenden Verletzungen entweder rekonstruieren oder die Hypothese falsifizieren.
Bei dem Oberschenkelknochen aus der Computeranimation war zuerst ein Reitunfall als Ursache angenommen worden. „Für diese Zeit war Reiten bisher noch nicht nachgewiesen worden“, erklärt Harten-Buga, „insofern war es wichtig herauszufinden, ob es sich tatsächlich um eine Reitverletzung handelt.“ Das war nicht der Fall, wie die beiden Wissenschaftlerinnen erkannten. „Wir haben festgestellt, dass der Reitunfall nach unseren Berechnungen ausgeschlossen werden kann“, bilanziert Schwinning. „Wir haben stattdessen herausgefunden, dass die Verletzung sehr wahrscheinlich von einer handgeführten Waffe, genauer einer Lanze, verursacht wurde. Damit haben wir eine Hypothese, die lange existiert hat, widerlegen können.“ Die Vorteile der rein digitalen Methode sind vielfältig: Die Analysen sind genauer, reproduzierbar – und absolut zerstörungsfrei.
Im neuen DFG-Projekt soll der Prozess weiter verfeinert werden. Denkbar sind dabei zum einen neue Ansätze, etwa bei der Frage, welche Merkmale Verletzungsspuren zeigen, wenn jemand Schutzkleidung getragen hat. Zum anderen soll eine Datenbank aufgebaut werden, die dann auch von anderen Fachrichtungen genutzt werden kann. Mit der Rechts- und der Unfallmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gibt es bereits einen engen Austausch; auch mit dem Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen (Italien), wo unter anderem Ötzi verwahrt wird, stehen die Wissenschaftlerinnen in Kontakt. Fortsetzung folgt.
DFG-Projekt
Das Projekt „Paläomechanische Untersuchungen zur Kohärenz von Verletzungsmustern und Waffeneffizienz an bronzezeitlichen Menschenknochen und Waffenfunden“ unter Leitung von Prof. Dr. Frank Nikulka ist 2017 gestartet und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für drei Jahre gefördert. An dem Projekt sind auch die FU Berlin (PD Dr. Jörg Orschiedt) und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (Dr. Detlef Jantzen) als Mitantragsteller beteiligt. Zudem bestehen unter anderem Kooperationen mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem Fachbereich Physik der Universität Hamburg und der TU Hamburg-Harburg. Mehr Informationen auch in diesem Fernsehbeitrag:
www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/archaeologie-114.html