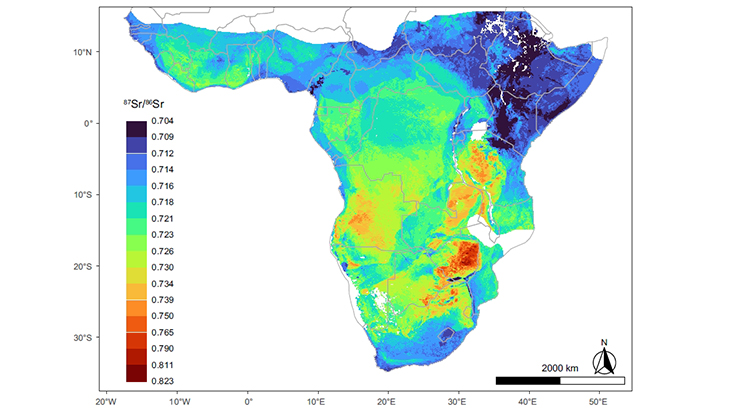Wie viel Ökologie verträgt unsere Wirtschaft? Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Timo Busch
6. Februar 2018, von Giselind Werner

Foto: Busch
Ein nachhaltiges Leben zeichnet sich dadurch aus, dass Ressourcen geschont werden. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Wege: Konsum von Überflüssigem vermeiden, solchen von Einwegprodukten reduzieren, den verbleibenden Müll recyceln oder kompostieren. Das führt im Grunde dazu, dass nachhaltig lebende Menschen weniger konsumieren. Wie verträgt sich das mit dem Primat und der Prosperität der Wirtschaft in unserer Gesellschaft? Ein Interview mit Prof. Dr. Timo Busch, der zu Management und Sustainability forscht.
Ich habe mir vorgenommen, im Januar und eigentlich das ganze Jahr über nichts zu kaufen, außer Essen. Bin ich eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil ich nicht mehr konsumiere?
Wenn eine Vielzahl von Menschen sich dauerhaft so entscheiden würde, dann wäre dies sicher eine ziemliche Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bei Ihnen alleine mache ich mir da keine Sorgen.
Nein, aber im Ernst: Selbst wenn Sie das ganze Jahr außer Lebensmitteln nichts kaufen würden: Irgendwann werden die Sachen, die Sie jetzt besitzen – und vorbildlich einfach weiter nutzen, so lange es geht – ihren Geist aufgeben oder einfach verschlissen sein. Hier gilt es dann, sinnvoll den Ressourcenkreislauf wieder zu schließen, also nach Möglichkeit die verwendeten Ressourcen zu recyceln.
Wenn Sie aber Neues kaufen müssen, sollten das Produkte sein, die möglichst lange halten, reparierbar sind und am Ende der Nutzungsdauer nicht auf der Deponie landen, sondern in irgendeiner Form wiederverwertet werden können. Für Unternehmen heißen die Stichworte hier übrigens „Kreislaufwirtschaft“ und „Design for Environment“ – im Gegensatz zum „Design for Obsolescence“, nach dem viele Produkte bewusst so angelegt sind, dass sie nach einer bestimmten Zeit kaputtgehen und nicht einfach repariert werden können.
„Kreislaufwirtschaft“ und „Design for Environment“ stehen beide nicht im Widerspruch zur Prosperität der Wirtschaft. Selbst wenn sich eine Vielzahl von Menschen zu diesem Lebensstil bekennt und entsprechend konsumiert, könnten wir weiter gut leben, der Ressourcenverbrauch würde drastisch zurückgehen und es käme zu keiner Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Im Gegenteil, aufgrund der Nachfrage würde sich die Wirtschaft fit machen für eine nachhaltigere Zukunft.
Wofür genau plädieren Sie?
Wir brauchen einen Zwei-Stufen-Plan, um unser Bewusstsein zu ändern. Im ersten Schritt muss das Bewusstsein der Konsumenten geschärft werden, dass wir dringend unseren Konsumstil ändern müssen und wirklich jeder gefordert ist. Das Ziel wäre: weniger Ressourcenverbrauch, weniger CO2-Emissionen und qualitativ bessere und langlebigere Produkte.
Dabei muss die Wirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Die beschriebene Veränderung des Konsumstils kann nicht ohne das entsprechende Angebot realisiert werden. Daher ist es im zweiten Schritt mindestens genauso wichtig, dass auch das Bewusstsein in der Wirtschaft für die Notwendigkeit zu mehr Nachhaltigkeit weiter wächst. Die Forschung zeigt, dass sich so auch Wettbewerbsvorteile generieren lassen.
Sie forschen zu Nachhaltigkeit in Industrieunternehmen, unter anderem gehen Sie der Frage nach, wann sich ökologisches Verhalten für Unternehmen auch finanziell lohnt. Was haben Sie herausgefunden?
Im lokalen Kontext haben wir im Rahmen eines Forschungsprojekts mit einem Hamburger Unternehmen zusammengearbeitet, für das das Thema „Energie“ in der Vergangenheit nie eine Rolle gespielt hat – getreu dem Motto: Der Strom kommt ja aus der Steckdose.
Nachdem wir intensiv recherchiert und analysiert haben, zeigte sich, dass sich durch relativ einfache Energie-Effizienz-Maßnahmen mehrere Zehntausend Euro pro Jahr einsparen lassen – und das ohne große Investitionen. Die Geschäftsführung war entsprechend begeistert.
In einer anderen Studie haben wir die existierende akademische Literatur zu dem Thema mit einer Meta-Analyse zusammengefasst. Hierfür haben wir mehr als 2.000 Studien analysiert, die die Folgen von unternehmerischer Nachhaltigkeit auf finanzielle Performance untersucht haben.
Wir fanden heraus, dass nur ein Bruchteil der Studien zu dem Ergebnis kommt, dass Nachhaltigkeit mit finanziellen Einbußen einhergeht. Im Gegenteil: Weit über die Hälfte aller akademischen Studien kommt zu dem Schluss, dass sich Nachhaltigkeit finanziell lohnt.
Welche Maßnahmen halten Sie für am effektivsten, wenn es darum geht, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern?
Wie gesagt glaube ich nicht, dass wir auf eine stringente, weitreichende Politik warten sollten. Dazu sind die Zeitfenster viel zu eng. Bestes Beispiel hierzu sind die Diskussionen kürzlich zu den deutschen Klimazielen.
Vielmehr glaube ich, dass vom Finanzmarkt eine sehr starke Lenkungsfunktion ausgehen kann. Zum einen zeigen ja die Studien: Nachhaltigkeit rechnet sich in den meisten Fällen. Dann sollte es doch mein ureigenes Interesse als Investor oder Dienstleister für Investoren sein, die Fälle zu identifizieren, wo mehr Nachhaltigkeit zu besserer Rendite führt.
Um die Idee eines nachhaltigen Finanzmarktes weiter zu forcieren und akademisch zu begleiten, wurde an der WiSo-Fakultät letztes Jahr beispielweise die „Research Group on Sustainable Finance“ ins Leben gerufen. Zurzeit gehören der Forschungsgruppe vier Professuren an.
Die Forschungsgruppe „Sustainable Finance“ untersucht die Rolle des Finanzmarkts and von Investitionen in Nachhaltigkeit für Unternehmen.