Bücher, Serien und EngagementAcht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Tipps für die freie Zeit zu Hause
9. April 2020, von Anna Priebe

Foto: pixabay/StockSnap
Lagerkoller und Langeweile sind angesichts von Kontaktsperre und einem quasi nicht mehr existenten Freizeitangebot echte Herausforderungen. Expertinnen und Experten der Universität Hamburg geben Tipps, wie man die freie Zeit zu Hause übersteht.
7 Empfehlungen zum Durchklicken
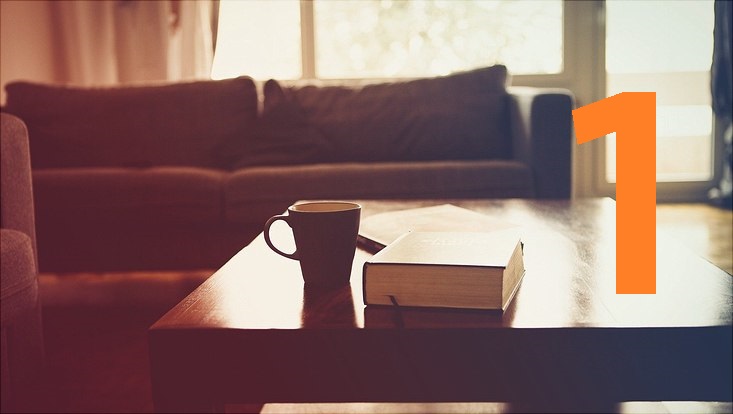
Foto: pixabay/Free-Photos
Wie kann man Kindern die Corona-Krise erklären?
Prof. Dr. Kerstin Michalik ist Professorin für die Didaktik des Sachunterrichts an der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem das Philosophieren als Unterrichtsprinzip im Sachunterricht sowie Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen.
Zunächst ist es dafür wichtig, herauszufinden, was die Kinder selbst bewegt, um auf konkrete Fragen und Ängste eingehen zu können: Was möchtest du gern wissen? Was macht dir vielleicht Angst? Und es ist wichtig, ehrlich zu antworten: Was weiß man bisher, was ist noch ungeklärt. Die Kinder entscheiden selbst, was sie wissen möchten und verarbeiten können. Das ist natürlich immer auch vom Alter der Kinder abhängig. Grundsätzlich geht es darum, Fragen der Kinder ernst zu nehmen und aufzuklären, ohne Angst zu machen. Das Ziel ist nicht, medizinisches Fachwissen zu vermitteln.
Für die meisten Kinder dürfte die Frage im Vordergrund stehen, weshalb sie nicht mehr in den Kindergarten und in die Schule gehen dürfen, warum man Oma und Opa nicht mehr sehen kann und warum im öffentlichen Leben besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Das ist relativ einfach zu erklären: Es gibt zurzeit eine neue ansteckende Krankheit, und man möchte erreichen, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben.

Foto: pixabay/Free-Photos
Welche Klassiker sollte man sich jetzt vornehmen?
Prof. Dr. Bernhard Jahn ist Professor für deutsche Literatur des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit und forscht am Institut für Germanistik zu „deutscher Literatur vom 15. Jahrhundert bis einschließlich Goethezeit – mit gelegentlichen Ausflügen in die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts“.
Was liest man in epidemischen Zeiten, wenn Albert Camus‘ Roman ‚Die Pest‘ im Buchhandel vergriffen ist und in Internet-Antiquariaten selbst für stockfleckige Taschenbuchausgaben 30 Euro verlangt werden?
Giovanni Boccaccios ‚Dekameron‘, eine aus hundert Geschichten bestehende Novellensammlung, ist ebenfalls ein Pest-Buch. Die Pest in Florenz im Jahre 1348 lässt eine Gruppe von Adligen auf einen Landsitz fliehen, wo sie sich die Zeit mit dem Erzählen von Geschichten vertreiben. Fortuna und Amor stehen dabei im Zentrum. Ein umfangreiches Buch, aber gut zu lesen, weil es abwechslungsreich erzählt und leicht zu portionieren ist.
Hans Jacob Christoph von Grimmelshausens ‚Simplicissimus Teutsch‘ führt seine Leserinnen und Leser in das Elend des Dreißigjährigen Krieges. Wie aktuell dieser Roman aus dem Jahre 1668 ist, erkennt man schon daran, dass auch das Toilettenpapier, das damals noch anders hieß, eine Stimme erhält und sich bitterlich über die Menschen beklagt. Eine anspruchsvolle Lektüre. Wer diesen Berg besteigen möchte, kann die Seilbahn nehmen: eine bearbeitete modernisierte Ausgabe. Oder zu Fuß gehen: Im Reclam-Verlag gibt es die Original-Fassung. Für diejenigen, die süchtig werden, hat Grimmelshausen mehrere Fortsetzungen verfasst.
Als absoluter Marathon kann die Lektüre von Hans Henny Jahnns Roman ‚Fluß ohne Ufer‘ gelten, der ab 1949 erschien. Der kurze einleitende Roman der Trilogie, ‚Das Holzschiff‘, ist dabei so spannend, dass ein Aufhören nach diesem ersten Teil fast unmöglich wird: Ein blinder Passagier auf einem Schiff beobachtet, wie seine Geliebte, die Tochter des Kapitäns, auf mysteriöse Weise verschwindet.

Foto: pixabay/Free-Photos
Welche Vögel kann man in Hamburg vom Küchenfenster aus beobachten?
Dr. Veit Hennig ist Biologe am Institut für Zoologie und forscht in der Arbeitsgruppe „Tierökologie und Naturschutz“. Einer seiner Schwerpunkte ist die Stadtökologie, wobei er sich unter anderem mit den Anpassungsstrategien von Vogelarten beschäftigt.
Momentan kann man viele Kohl- und Blaumeisen beobachten, die sich oft um die Belegung von Nistkästen streiten. Sie gehören zu den häufigsten Arten im Siedlungsbereich. Morgens hört man meist Rotkehlchen singen, über den Tag sind es eher Dompfaffen. Weitere besonders aktive Sänger sind zudem Zaunkönige, Heckenbraunellen und Singdrosseln. Der Vogelgesang ist übrigens dazu gedacht, Rivalen fern zu halten und ist alles andere als nett gemeint. Wer singt, kann nicht fressen und exponiert sich für Fressfeinde.
Besonders auffällig ist gerade auch der Nestbau der Elstern. Sie bauen es mit schützendem Dach, damit ihnen die Eier nicht von anderen Beutegreifern wie Krähen geraubt werden. Weil Menschen öfter Elstern und Krähen beim Fressen von Eiern und Küken anderer Vogelarten sehen, werden sie für das Verschwinden von Singvögeln verantwortlich gemacht. Dabei gehört die Elster selbst zu den Singvögeln und erfährt momentan einen gravierenden Rückgang.
Übrigens kann man mit seinen Beobachtungen auch die Wissenschaft unterstützen. Unter dem Motto „#StayHomeAndWatchOut“ sammelt der Dachverband Deutscher Ornithologen im Online-Portal ‚Ornitho‘ Verbreitungsdaten. Die Anmeldung ist kostenlos und nach zehn Beobachtungseingaben kann man alle aktuellen Beobachtungsdaten von Vögeln der Umgebung abfragen. An manchen Tagen kommen so mehr als 60.000 Beobachtungen zustande. Diesen März waren es mehr als 730.000 Erfassungen.

Foto: pixabay/Free-Photos
Wie kann man Lagerkoller in der Familie vorbeugen?
Dr. Dipl.-Psych. Anne-Katharina Fladung ist Geschäftsführende Leiterin der Hochschulambulanz und forscht unter anderem zu Emotionsregulationsprozessen.
Sich in der Familie gegenseitig sozial unterstützen
Zentral ist, dass wir miteinander reden. Die Wissenschaft zeigt, dass während und nach emotionalen Ereignissen – und zu denen zählt auch eine Pandemie wie Corona – der Drang steigt, über das Geschehene nachzudenken und zu sprechen. So wird der Prozess des sozialen Teilens angestoßen: Durch den Austausch wird das Geschehene in den eigenen Gedanken sortiert und kann in das eigene Welt- und Menschenbild eingeordnet werden. Außerdem mindert das Gespräch Gefühle der Einsamkeit und fördert sozialen Zusammenhalt.
Sprechen hilft so übrigens auch Verwandten, Nachbarn und Bekannten. Allen Familienmitgliedern, auch den Kleinsten, sollte erlaubt sein, über die eigenen Gefühle zu sprechen und sie gewürdigt zu wissen. Kinder, die aktuell traurig sind, ihre Freunde nicht treffen zu können, brauchen nicht immer einen Vortrag über den Sinn sozialer Distanz in diesen Zeiten, sondern manchmal einfach die Bestätigung, dass das auch traurig ist und die anderen Familienmitglieder das gut nachvollziehen können.
Man sollte allerdings darauf achten, nicht in ein übermäßiges gemeinsames Grübeln über die Umstände zu verfallen. Es sollte keinen zusätzlichen Stress verursachen, im Austausch zu sein. Wichtige Gespräche zum Einordnen sollten nicht in den Abendstunden geführt werden und auch große Konflikte sollten momentan eher zurückgestellt werden.
Struktur ist wichtig
Nicht erst seit Daniel Defoes Robinson Crusoe wissen wir, wie hilfreich es ist, in Zeiten von Stress so viel Routine wie möglich beizubehalten – das steigert die Vorhersagbarkeit in unsichere Zeiten und fördert die psychische Gesundheit. Vielfach wissenschaftlich belegt sind die Grundlagen für ein gesundes Wohlbefinden: Für alle Familienmitglieder sind ausreichend Schlaf, gesundes Essen und Bewegung wichtig – planen Sie das jeden Tag bewusst ein. Und versuchen Sie, im gewohnten Alltag zu bleiben: Wenn Kinder dienstags beim Sport waren, sollten sie dienstags Sport zur selben Zeit betreiben. Wenn die Mutter morgens regelmäßig einen Kaffee mit der Arbeitskollegin trank, kann sie sich zur selben Zeit mir ihr im Videochat zu einem Kaffee treffen.
Bedenken Sie, dass Kinder ein anderes Zeiterleben haben als Erwachsene. Hier kann es hilfreich sein, einen Kalender zu malen und zeitliche Abläufe über das Abhaken von Aufgaben pro Zeiteinheit greifbarer zu machen. Vor allem für Kinder, die sich zwingen müssen, täglich wenigstens ein bisschen für die Schule zu tun, kann es hilfreich sein, die Reihenfolge von Aktivitäten so zu planen, dass Lieblingstätigkeiten den Schulaufgaben zeitlich folgen („erst die Arbeit, dann das Vergnügen!“). Zudem sollte versucht werden, für die ganze Familie ein gemeinsames Highlight pro Tag einzuplanen, etwa abends Familienfilme schauen oder zusammen Mogel-Monopoly spielen.
Wichtig dabei: Seien Sie nachsichtig mit sich und den anderen. Wenn der Plan im Großen und Ganzen eingehalten werden kann, ist es gut, wenn es mal nicht so klappt, ist das auch nicht schlimm.
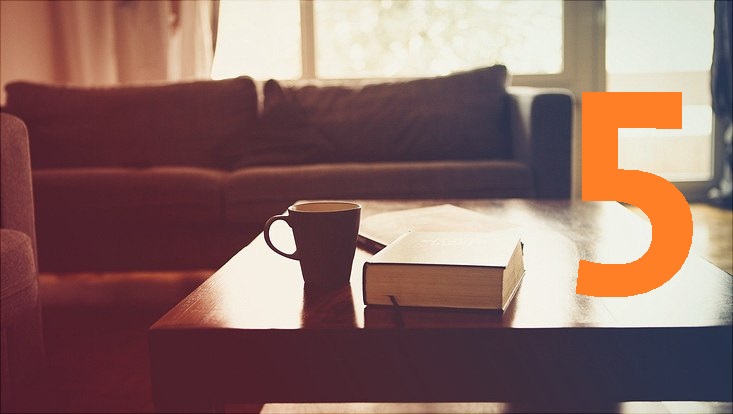
Foto: pixabay/Free-Photos
Welche Musikstücke können einen am besten aus der Wohnung entführen?
Prof. Dr. Ivana Rentsch ist Leiterin des Instituts für Historische Musikwissenschaft und forscht zum Beispiel zu kulturhistorischen Fragestellungen sowie zur Theorie der Musik der Frühen Neuzeit.
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9. Beethovens „Ode an die Freude“ war eines der Lieder, mit dem von deutschen Balkonen gegen die Corona-Krise angesungen wurde. Die Wahl ist äußerst glücklich, denn die ‚Ode an die Freude‘ steht nicht für sich allein, sondern ist der Erlösungsschluss von Beethovens letzter Sinfonie. Die überwältigende Wucht der allgegenwärtigen Melodie – die u. a. zum Klingelton, Werbesong oder für Warteschleifen eingedampft wurde – kann jedoch nur erfahren, wer das musikalische Tal vom Beginn der 9. Sinfonie bis zum quälenden Chaos zu Beginn des vierten Satzes durchschritten hat. Wenn sich nach zähem Ringen schließlich die strahlende ‚Ode‘ in Dur gegen das dissonante Inferno durchsetzt, kann man die Erlösung geradezu physisch erleben. Es ist die Gelegenheit, im Beethoven-Jahr das vermeintlich bekannteste Stück des Komponisten neu zu entdecken.
Dmitri Schostakowitsch: Suite für Varieté-Orchester. Zu der aktuellen Stimmung passt Schostakowitschs ebenso populäre wie ambivalente Suite ausgezeichnet: Sie changiert zwischen Jazzklängen und Walzerrhythmen, Melancholie und Gelassenheit. Am berühmtesten ist zweifellos der Walzer Nr. 2, der von Schostakowitsch ursprünglich als Filmmusik komponiert worden war und unter anderem in Stanley Kubricks ‚Eyes Wide Shut‘ und Lars van Triers ‚Nymphomaniac‘ die irreale Stimmung potenziert. Die Qualität der eingängigen Nummern, die Schostakowitsch allesamt unter dem Eindruck der persönlich erfahrenen Repressionen durch Stalin verfasste, liegt gerade in ihrer unüberhörbaren Doppeldeutigkeit.
Camille Saint-Saëns: Karneval der Tiere. In Zeiten, in denen Zoos und Kitas geschlossen sind, kann der tierische Klassiker nur wärmstens empfohlen werden. Die Komposition besteht aus 14 Nummern, die durch kurze, je nach Aufnahme unterschiedliche Zwischentexte miteinander verbunden sind. Nacheinander haben verschiedene Tiere ihren Auftritt: Die feierliche Vorstellung des königlichen Löwen eröffnet den Reigen, worauf von hektischen Hühnern über eine Cancan-Parodie der langsamen Schildkröten, einen Tanz der Elefanten oder die rasend schnellen Xylophon-Läufe der Fossilien eine ganze Menagerie an Auftritten folgt. Nach der berühmten Schwanen-Nummer – womöglich Saint-Saëns’ erfolgreichste Komposition – werden die unterschiedlichen Tiermusiken in einem grandiosen Finale zusammengeführt. Es handelt sich um eine der wenigen Kompositionen der Musikgeschichte, bei denen alle zwischen drei und 100 Jahren gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Foto: pixabay/Free-Photos
Welche Serien können jetzt ablenken?
Prof. Dr. Judith Ellenbürger forscht am Institut für Medien und Kommunikation unter anderem zu digitalen audiovisuellen Medien wie Filmen, Fernsehserien und Sitcoms sowie zu Gendertheorien.
Zwar werben die großen Streaming-Dienste nun auch mit breit angelegten Serien zum Thema, etwa Netflix mit ‚Pandemic (2020)‘, aber hier wird teilweise mit dramatischen Formulierungen und Modellansichten Angst geschürt. Empfehlen würde ich daher andere Serien.
Für alle, die sich in Krisen auch für den Finanzmarkt interessieren: Bad Banks (2018). Die deutsch-luxemburgische Co-Produktion stellt eine junge Investmentbankerin und die Entwicklung ihrer Karriere in den Mittelpunkt der Handlung und weicht damit von den gängigen Finanzmarktnarrativen mit fast ausschließlich Männern als Protagonisten ab. Ihre Stärke liegt darin, nah an ihr und anderen Figuren zu erzählen, die Krisen als persönliche Krisen darzustellen und Spannung über Thriller-Elemente aufzubauen. Eher lästige Erklär-Dialoge fallen hier weg.
Für diejenigen, die sich in der schweren Zeit ihren Humor erhalten wollen: The Marvelous Mrs. Maisel (2017). Die Idee zu der Fernsehserie stammt von Amy Sherman-Palladino, die zuvor die ‚Gilmore Girls' realisiert hat und für ihre besonderen Charaktere und ungewöhnlichen Gender-Konstellationen bekannt ist. Diese Serie handelt von einer jüdischen Hausfrau und Mutter, die von ihrem Mann verlassen wird und Ende der 1950er-Jahre eine Karriere als Stand-up-Comedian einschlägt. Dabei denkt die Serie die Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft sowie in der Tradition der Komödie konsequent mit und wird so auf mehreren Ebenen zu einer kuriosen und witzigen Geschichte der Selbstbefreiung und Selbstverwirklichung.
Für Fans des aktuell boomenden True-Crime-Formats: American Crime Story: The People v. O. J. Simpson (2016). Wie der Titel bereits verrät, dreht sich die erste Staffel dieser Serie um den berühmten Strafprozess gegen den Footballstar O. J. Simpson, der wegen Mordes an seiner Ex-Frau und deren Freund angeklagt wurde. Dabei zeichnet die Serie nicht nur den Prozess minutiös nach, sondern beleuchtet alle Blickwinkel, zeigt eine gespaltene amerikanische Gesellschaft und bleibt bis zum Schluss ambivalent.

Foto: pixabay/Free-Photos
Welche Comics empfehlen sich für spannende Nachmittage auf dem Sofa?
Prof. Dr. Astrid Böger vom Institut für Anglistik und Amerikanistik leitet – gemeinsam mit Prof. Dr. Joan Bleicher – die Arbeitsstelle für Graphische Literatur an der Universität Hamburg und forscht unter anderem zu visueller Kultur und Populärkultur.
Die Populärkultur übernimmt eine wichtige Funktion der Rückversicherung von Menschen und ganzen Kulturgemeinschaften – besonders in Krisenzeiten. Der Bereich der Comics und Graphic Novels ist hierfür ein gutes Beispiel. Meine Lektüreempfehlungen in Zeiten der Corona-Pandemie:
1. Gröcha. Diese Graphic Novel von der französischen Zeichnerin Peggy Adam (avant-Verlag, 2014) ist nichts für schwache Nerven. Adam präsentiert darin ein fiktives epidemisches Geschehen in Europa, das in den Augen vieler Leserinnen und Leser unserem derzeitigen Leben in der Corona-Krise mit sozialer Distanzierung, vermehrter staatlicher Überwachung und vor allem einem um sich greifenden Klima der Angst fast schon beunruhigend ähneln dürfte.
2. The Walking Dead. Die meisten dürften diese serielle Erzählung einer US-amerikanischen Postapokalypse von Robert Kirkman (Autor), Tony Moore und Charly Adlard (Zeichner) aus dem Fernsehen kennen, aber berühmt wurde sie zunächst als langlaufende Comic-Serie (2003–2019), die 2010 mit dem renommierten Will-Eisner-Award ausgezeichnet wurde und auch kommerziell alle Rekorde gebrochen hat. Auch wenn es hier auf den ersten Blick um eine Zombie-Apokalypse geht, dreht sich ‚The Walking Dead‘ zentral um die Frage des Überlebens in einer völlig veränderten Welt, in der alle Standards des zivilen Miteinanders in der menschlichen Gemeinschaft auf dem Prüfstand stehen und mitunter brutal durchgesetzt werden müssen.
3. Schließlich noch eine Empfehlung für die Internet-affinen und forschungsinteressierten Comic-Freundinnen und -Freunde. Seit einigen Jahren etabliert sich der Bereich der ‚graphic medicine‘, wobei Medizinerinnen und Mediziner, Kulturschaffende sowie Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gemeinsam der Frage nachgehen, warum Comics so besonders gut geeignet sind, bei der Krisenbewältigung etwa von ernsten Krankheiten zu helfen. Im Internet gibt es ein interessantes Angebot, bei dem sich tagesaktuell verfolgen lässt, was von Comiczeichnerinnen und -zeichnern zu Corona und Covid-19 veröffentlicht wird. Neben vielen ernsten Beiträgen finden sich hier auch humorvolle Cartoons, die dem Thema ein wenig Leichtigkeit verleihen können.

Foto: pixabay/Free-Photos
Wie kann ich mich von zu Hause aus ehrenamtlich engagieren?
Cornelia Springer ist wissenschaftliche Koordinatorin des Projektes „Engagementförderung durch universitäre Lehre“ (EngföLe)“ im Studiendekanat der Fakultät für Geisteswissenschaften. EngföLe soll den Wissenstransfer zwischen Universität und Zivilgesellschaft verbessern und das ehrenamtliche Engagement der Studierenden stärken.
Am nächstliegenden und einfachsten ist Helfen im direkten Umfeld. Vor allem ist es wichtig, Menschen zu unterstützen, die zur Risikogruppe gehören und deshalb ihre täglichen Erledigungen nicht wie gewohnt vornehmen können. Auch Familien mit Schul- oder Kita-Kindern können Unterstützung gebrauchen. Helfen kann man zum Beispiel, indem man anbietet, Einkäufe zu erledigen, Medikamente aus der Apotheke abzuholen oder bei der Kinderbetreuung zu entlasten. Zur Kontaktaufnahme kann man einen Zettel ins Treppenhaus hängen oder sich auf Nachbarschaftsplattformen wie Gemeinsame Sache vom Hanseatic Help e.V., der Corona Nachbarschaftshilfe der Hamburger Freiwilligenagenturen oder nebenan.de registrieren.
Ein besonderes Augenmerk sollte auch darauf liegen, Einsamkeit zu bekämpfen, indem man zum Beispiel Angehörige und Bekannte in dieser Zeit öfter anruft und ihnen Zeit ‚spendet‘. Wer niemanden persönlich kennt, den er oder sie anrufen kann, kann auch an der ‚Aktion Hoffnungsbrief‘ der Diakonie teilnehmen, die Briefe sammelt und an Menschen in Alten- und Pflegeheimen verteilt.
Ein nicht zu unterschätzendes Thema, das auch unser Studienprogramm ‚Hamburg für alle – aber wie?‘ direkt berührt, ist die Zuspitzung der prekären Lage für obdachlose Menschen, deren gesamtes Versorgungsnetzwerk nach und nach zusammenbricht. Eine Hilfe, die man von zu Hause aus leisten kann, besteht hier in erster Linie in Geldspenden, zum Beispiel an das eigens eingerichtete Projekt StraßenSPENDE für Obdachlose während Corona.
Und: Experten befürchten einen Anstieg von psychischen Belastungen und häuslicher Gewalt in der aktuellen Ausnahmesituation mit sozialer Isolation, räumlicher Enge und häufig zusätzlichen Sorgen um die wirtschaftliche Existenz. Betroffene können Servicenummern konsultieren und sich mit einer Beratungs- oder Interventionsstelle für Häusliche Gewalt in Verbindung setzen lassen. Dafür wenden sie sich entweder an die Polizei oder an das Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08000 / 116 016. Aber auch als Nachbarin oder Nachbar kann man sich an die Polizei wenden, wenn man begründeten Verdacht auf häusliche Gewalt hat. Zivilcourage ist in Krisenzeiten umso wichtiger.


