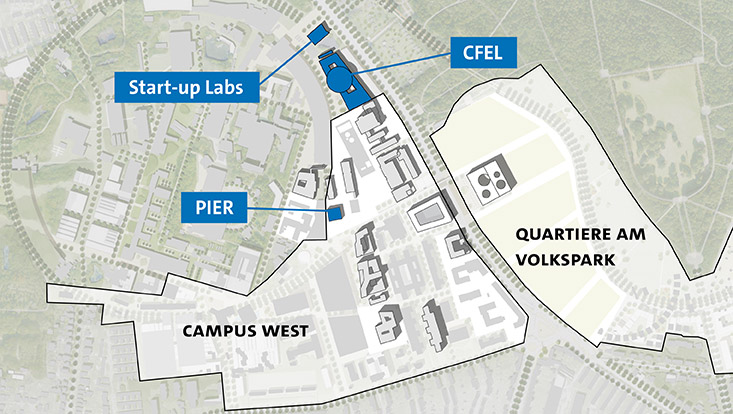Neue Dekanin an der Fakultät für Geisteswissenschaften„Ich möchte bestehende Projekte fortführen, neue anstoßen und für mehr Sichtbarkeit der Geisteswissenschaften sorgen“
16. März 2021, von Tim Schreiber

Foto: privat
Seit dem 1. März 2021 ist Prof. Dr. Silke Segler-Meßner neue Dekanin der Fakultät für Geisteswissenschaften. Im Interview spricht sie über ihre neue Rolle, ihre Motivation sowie über die Folgen der Corona-Pandemie.
Frau Segler-Meßner, Sie waren seit 2014 Prodekanin für Studium und Lehre und sind nun zur Dekanin gewählt worden. Was ist Ihre Motivation, Führungsämter zu übernehmen?
Ich bin Prodekanin geworden, weil sich die Studiengänge seit der Bologna-Reform sehr geändert haben und mir die Belange der Studierenden sehr wichtig sind. Die Herausforderung war und ist es, Studienbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, auch in einem modularisierten System Studierbarkeit zu gewährleisten und Räume für projektorientiertes Arbeiten zu schaffen.
Die Entscheidung, mich für das Amt der Dekanin zur Wahl zu stellen, ist aus dem Wunsch erwachsen, meine im Studiendekanat erworbenen Erfahrungen auf Fakultätsebene auszubauen und zu vertiefen. Ich arbeite sehr gern im Team und engagiere mich für gemeinsame Vorhaben und die Etablierung neuer Kommunikationsstrukturen. Die Überzeugung, das Profil und den Zusammenhalt in unserer Fakultät stärken zu können, hat mich motiviert, diese Leitungsfunktion zu übernehmen.
Wie gehen Sie Ihre neue Rolle nun an?
Als Dekanin verfüge ich über einen begrenzten Gestaltungsspielraum, kann jedoch Akzente setzen. Ich verstehe mein Amt als Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung bzw. zwischen Fakultät und Präsidium. Ziel ist es, im Gespräch mit den Fakultätsmitgliedern und in den Gremien eine lebendige Kultur des Miteinanders und zugleich der kritischen Auseinandersetzung aufzubauen. In diesem Zusammenhang kann ich Anregungen aufnehmen, die richtigen Personen miteinander vernetzen und Projekte voranbringen.
Welche Schwerpunkte werden Sie als Dekanin setzen?
Die Geisteswissenschaften leisten einen substantiellen Beitrag zur kritischen Kommunikation in unserer Gesellschaft. Ich möchte für mehr Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse und der innovativen Beiträge in der Lehre sorgen. Ein besonderer Reichtum unserer Fakultät ist die Vielfalt der kleinen Fächer, die es zu erhalten gilt.
Für die Forschung in unserer Fakultät verfolge ich ein doppeltes Ziel: Auf der einen Seite ist es mir ein Anliegen, bereits existierende Forschungsverbünde wie z. B. den Exzellenzcluster zu den Manuskriptkulturen oder andere Verbundprojekte wie das Graduiertenkolleg „Interkonfessionalität in der Frühen Neuzeit“, die Forschungsgruppe „Gewalt-Zeiten“ aus dem Fachbereich Geschichte in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, auf der anderen Seite dürfen individuelle Forschungsvorhaben nicht aus dem Blick geraten. Kolleginnen und Kollegen benötigen Räume des Austauschs, um erfolgreich Projekte entwickeln und sich vernetzen zu können. Hier möchte ich Gelegenheiten der Begegnung schaffen. Darüber hinaus wird sich unsere Fakultät dank der Nucleus-Professur des Historikers Ulf Schmidt an der Etablierung eines neuen Clusters zur Infektionsforschung beteiligen.
Weitere Schwerpunkte stellen die Fortsetzung unserer sehr lebendigen Studienreformkultur und die Weiterentwicklung einer innovativen Lehr- und Lernkultur dar. An unserer Fakultät ist das Studium Generale angesiedelt, an dem sich die Fakultät für Erziehungswissenschaft und die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften beteiligen. Ich möchte mich für den Ausbau des Studium Generale und die Entwicklung eines Profils engagieren, das den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts Rechnung trägt.
Wie ist Ihre Fakultät bislang durch die Pandemie gekommen?
Ich möchte vorausschicken, dass der kritische Dialog und die unterschiedlichen Fachkulturen von der konkreten Begegnung mit anderen Menschen leben. Insofern ist unser Ziel, möglichst bald zur Präsenzlehre und -forschung zurückzukehren, denn auch Ideen für neue Projekte entstehen häufig beim gemeinsamen Mittagessen oder Kaffee. Dennoch ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, innerhalb weniger Wochen fast unser komplettes Lehrprogramm in synchronen und asynchronen Formaten anzubieten. Alle Lehrende und Studierende haben sich mit einem außerordentlichen Engagement auf die neuen Formate eingelassen und somit die Fortsetzung des Lehrbetriebs ermöglicht.
Wird nach Corona etwas von der digitalen Lehre bleiben?
Aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten digitalen Sommersemester konnten viele Lehrende ihre Veranstaltungen interaktiver gestalten und mit neuen Methoden experimentieren. Evaluationen unter Studierenden haben gezeigt, dass vor allem die digitalisierten Vorlesungsformate von Podcast bis Lecture to go ein sehr positives Feedback erhalten. Viele Studierende und in erster Linie diejenigen unter ihnen mit Erziehungs- und Pflegeaufgaben oder mit Nebenjobs zur Finanzierung des Studiums schätzen die größere zeitliche Flexibilität, weil sie die Vorlesungen hören können, wenn es ihr Alltag erlaubt. Seminare oder sprachpraktische Veranstaltungen hingegen leben von dem Austausch in Präsenz. Dennoch wünsche ich mir, dass wir die erworbenen Erfahrungen für die konstruktive Weiterentwicklung von hybrider Lehre nutzen.
Als Dekanin werden sie dafür sicher etwas weniger Zeit haben, aber wo liegen derzeit Ihre größten Forschungsinteressen?
Im vergangenen Jahr ist meine Einführung in die französische Kulturwissenschaft erschienen, die sich an Studierende und Lehrende gleichermaßen richtet. Ich zeige darin in exemplarischen Close Readings die Methoden und Vorgehensweisen einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft, in der Themen wie Gender, Gedächtnis und Erinnerung sowie die Frage des kulturellen Selbstverständnisses eine zentrale Rolle spielen. Die Problematisierung des klassischen französischen Literaturkanons durch Autorinnen und Autoren aus ehemaligen französischen Kolonien in Subsahara-Afrika und die sogenannte Migrationsliteratur sorgt aktuell für viel Bewegung und Veränderung im Feld der Gegenwartsliteraturen. Ebenso wie in anderen europäischen Ländern bricht auch in Frankreich die Frage nach der Teilhabe an und der Stellung in dem Kulturbetrieb auf und führt zur Relektüre von Klassikern oder zur Kritik an der bisher dominant eurozentrischen Perspektive. Daneben beschäftige ich mich intensiv mit der medialen Vermittlung kultureller Traumata und der Frage, welchen Beitrag Literatur dabei leisten kann.
Zur Person
Prof. Dr. Silke Segler-Meßner studierte Romanistik und Germanistik an der Universität Bonn. Dort promovierte sie in der Italianistik. Nach ihrer Habilitation im Jahr 2003 an der Universität Stuttgart vertrat sie Professuren unter anderem an den Universitäten Potsdam, Frankfurt a. M. und Kassel. Seit 2010 ist sie Professorin für französische und italienische Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte sind unter anderem Geschlechterbeziehungen von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne, europäische Erinnerungskulturen nach der Shoah sowie Trauma und Zeugenschaft.