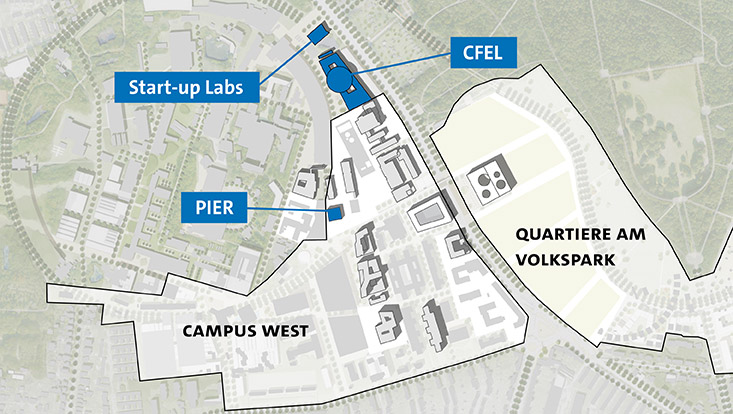Spitzentechnologie in der Manuskriptforschung:Tag der offenen Tür im Sonderforschungsbereich 950
31. Mai 2018, von Anna Priebe

Foto: Karsten Helmholz, SFB 950
Manuskripte sind oft die einzigen schriftlichen Quellen vergangener Kulturen. Sie zu untersuchen, stellt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor verschiedene Herausforderungen. Einblick in die Arbeit zwischen Natur- und Geisteswissenschaften bietet der Tag der offenen Tür des Sonderforschungsbereichs 950 am 1. Juni. Dr. Sebastian Bosch, Leiter der instrumentellen Analytik am „Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC)“, erzählt im Interview, was Besucherinnen und Besucher erwartet.
Manuskripte sind sehr vielfältig. Aus welchen Materialien bestehen sie in der Regel?
Manuskripte sind in der Tat sehr vielfältig, sowohl inhaltlich als auch materiell. Bis zur Erfindung des Buchdrucks waren sie das einzige Medium der Schriftlichkeit aller Kulturen weltweit. So überrascht es nicht, dass je nach geographischer Lage und natürlichen Ressourcen verschiedene Materialien für die Herstellung zum Einsatz kamen.
Die Art der Schriftträger erstreckt sich dabei von Ton über tierische Materialien wie Leder oder Pergament bis zu pflanzlichen Materialien wie Bambus, Palmblättern, Rinde, Papyrus und später Papier. Bei den Schreibmaterialien unterscheidet man in der Regel kohlenstoffbasierte Tinten aus Ruß oder Graphit, Pflanzentinten und die in den westlichen Kulturen meist verwendete Eisengallus-Tinte.
Aufgrund der Vielfalt der Rezepturen und der natürlichen Herkunft der Rohstoffe gibt es zahlreiche unterschiedliche Komponenten und Verunreinigungen in Schreibmaterialien.
Welche Fragestellungen können mit Materialanalysen von Manuskripten beantwortet werden?
Mithilfe von Materialanalysen ist es möglich, die Geschichte von Manuskripten zu rekonstruieren. Uns stehen dabei verschiedene instrumentelle Verfahren zur Verfügung, um die eingesetzten Materialien zu identifizieren und somit Rückschlüsse auf den Herstellungsprozess sowie Lagerung und Gebrauch der Manuskripte zu ziehen.
Neben einer allgemeinen Klassifizierung der Handschriften bezüglich der verwendeten Materialien offenbart uns deren chemische Beschaffenheit oft auch Hinweise auf deren Ursprung oder die Echtheit der Manuskripte. Weiterhin ist es möglich, absichtlich oder unabsichtlich gelöschte bzw. zerstörte Schriften wieder sichtbar zu machen.
Manuskripte sind Unikate und besitzen oft einen großen kulturellen Wert, deshalb müssen sie mit größter Sorgfalt behandelt werden. Unser Manuskriptlabor ist darum mobil und nichtinvasiv, sodass die wertvollen Manuskripte direkt vor Ort analysiert werden können, ohne Schaden davon zu tragen.
Können Sie exemplarisch eine gängige Analysemethode kurz erklären?
Eine sehr effektive Methode zur Identifizierung von Eisengallus-Tinten und farbigen Pigmenten ist die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Dabei werden die Manuskripte mit Röntgenlicht bestrahlt und Elektronen aus den Atomen der enthaltenen Materialien „herausgeschossen“.
Das führt zu einer kurzzeitigen Instabilität der Atome, die durch weitere Elektronenübergänge innerhalb des Atoms ausgeglichen wird. Dabei entsteht wiederum Röntgenlicht, welches spezifisch für das jeweilige Atom detektiert werden kann. Somit lassen sich die Materialien bezüglich ihrer elementaren Komposition sehr effektiv und vor allem nicht-invasiv charakterisieren.
Sie stellen Ihre Arbeit beim Tag der offenen Tür im mobilen Manuskriptlabor vor. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?
Das mobile Manuskriptlabor verbindet historisches Kulturerbe mit Spitzentechnologie. Die Besucherinnen und Besucher können vor Ort hautnah miterleben, wie jahrhundertealte Schriftstücke mittels moderner High-Tech-Verfahren analysiert werden und interessante Einblicke in die Materialität von Manuskripten erlangen.
Haben Sie ein Lieblingsmanuskript?
Als Chemiker interessieren mich besonders naturwissenschaftliche Schriftstücke, wie z. B. das Archimedes-Palimpsest. Dabei handelt es sich um das älteste existierende Manuskript von Archimedes in griechischer Sprache, das im 13. Jahrhundert von Mönchen mit christlichen Texten überschrieben wurde und nur mithilfe moderner Materialanalysen wieder sichtbar gemacht werden konnte.
Tag der offenen Tür im Sonderforschungsbereich 950 „Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa“
Am Freitag, 1. Juni, veranstaltet der Sonderforschungsbereich 950 „Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa“ seinen 7. Tag der offenen Tür. Dieses Mal wird Spitzentechnologie in der Manuskriptforschung im Fokus stehen. Von 14.30 bis 18 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm, bei dem verschiedene Projekte vorgestellt werden. Die Besucherinnen und Besucher können in der Warburgstraße 26 so die interdisziplinäre Arbeit von Geistes- und Naturwissenschaften im „Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC)“ kennenlernen. Mehr Informationen (PDF): www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cal-details/180601%20open%20house.pdf