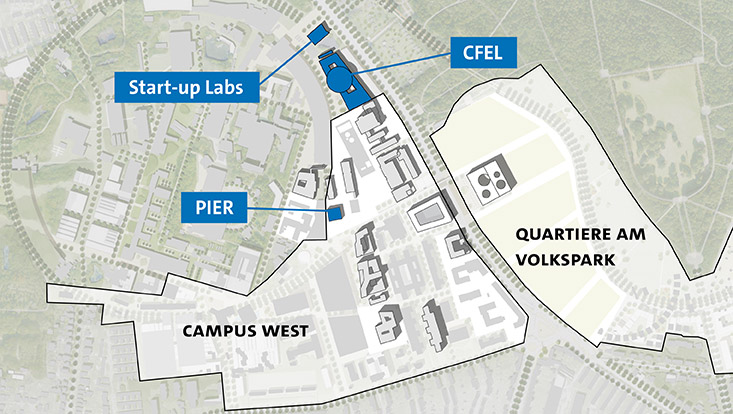Nachhaltigkeit in der Lehre – 5 Fragen an Prof. Dr. Stefanie Kley
2. Mai 2018, von Anna Priebe

Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz
Die Universität Hamburg hat sich der Nachhaltigkeit verpflichtet – nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre. Die Broschüre „Nachhaltigkeit in der Lehre – Perspektiven der Universität Hamburg“ stellt entsprechende Lehrangebote vor. Ein Gespräch mit Prof. Dr. Stefanie Kley, Professorin für Soziologie, insbesondere Ökologisierung und quantitative Methoden der Sozialforschung, die unter anderem das Vertiefungsseminar „Umweltbewusstsein in Deutschland“ angeboten hat.
Im Seminar bekamen die Studierenden nicht nur theoretischen Input zum Thema Umweltbewusstsein in Deutschland, sondern konnten selbst empirisch dazu arbeiten. Wie war der genaue Ablauf?
Das Seminar bestand im Grunde aus vier großen Blöcken: Als erstes ging es darum, wie Umweltsoziologie in Deutschland und Europa in die allgemeine Soziologie eingebettet ist und welche Aspekte aus der Ökologie für uns interessant sein könnten. Der zweite große Block waren die verschiedenen theoretischen Ansätze, um umweltbezogene Einstellungen und entsprechendes Verhalten zu erklären. Und dann gab es einen dritten Block – überschrieben mit „aktueller Forschung“; da haben wir uns deutschsprachige und auch englischsprachige Artikel angeschaut, die in soziologischen Fachzeitschriften erschienen sind.
Diese Einführung sollte den Studierenden einen möglichst breiten Überblick darüber ermöglichen, was in diesem Bereich überhaupt erforscht wird, um sich dann selbst ein Thema suchen zu können, das sie im vierten Block empirisch untersuchen möchten.
Wie wurde Nachhaltigkeit dabei verstanden?
Die Auseinandersetzung hat stark entlang der ausgewählten Literatur stattgefunden. In erster Linie bedeutete das Nachhaltigkeit im Sinne von Ökologie und Umweltbewusstsein. Da ging es zum Beispiel um die Frage, was die EU unter ökologisch sinnvollem Wirtschaften versteht und wie das umgesetzt werden soll. Andere Texte hatten eher mikrotheoretische Fragestellungen, zum Beispiel welche Personen überhaupt daran interessiert sind, CO2-Emissionen einzusparen und wie man es erklären kann, dass manche Leute umweltbewusster sind als andere.
Können Sie beispielhaft ein oder zwei der studentischen Projekte nennen?
Die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben entweder alleine oder zu zweit gearbeitet. Als Basis diente der Datensatz „Umweltbewusstsein in Deutschland“. Das ist eine repräsentative Studie, die in verschiedenen Jahren wiederholt durchgeführt wurde.
Eine Hausarbeit hat sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, ob das Einkommen einen Einfluss auf das Umweltverhalten hat. Weitere Arbeiten gab es zu den Fragen, inwiefern die indirekte Betroffenheit von Umweltkatastrophen – also zum Beispiel durch die Berichterstattung in den Medien – das Umweltbewusstsein beeinflusst, und welche Bevölkerungsgruppen „grüne“ Produkte kaufen.
Haben Sie das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Lehre und bei den Studierenden präsent ist?
Ja, in unserem Fachbereich ist es auf jeden Fall sehr präsent. Wir haben hier in der Soziologie viele Leute, die zu diesem Thema forschen, und die wollen dann natürlich auch dementsprechende Seminare anbieten. Ich mache die Programmdirektion und habe dadurch einen ganz guten Überblick darüber: Wir haben eigentlich jedes Semester mindestens zwei Veranstaltungen aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Das Seminar „Umweltbewusstsein in Deutschland“ war auch wirklich gut nachgefragt. Die Möglichkeit, selbst Analysen – auf der Basis von theoretischen Überlegungen – durchzuführen, wird sehr gerne gewählt.
Ihre Professur ist Teil einer Clusterberufung in der Soziologie, um den fakultären Potenzialbereich „Nachhaltigkeit“ zu stärken. Wie genau greifen Sie den Aspekt in Ihrer Forschung auf?
Ein Projekt, das ich momentan plane, beschäftigt sich zum Beispiel mit Wohnstandort-Entscheidungen in Verbindung mit urbanen Grünräumen. Dabei geht es um die Frage, welche Bevölkerungsgruppen eigentlich gerne in durchgrünten Stadtteilen wohnen würden – in der Nähe von Parks, in der Nähe von Wasserflächen – und wer diese Wünsche tatsächlich umsetzen kann.
Das ist eine sehr aktuelle Frage – auch vor dem Hintergrund des momentanen Bebauungsdrucks, den wir haben. Der Wohnungsbau soll signifikant gesteigert werden und da kommt es häufig zu Konflikten um Grünflächen, wo die Anwohner dagegen protestieren, dass weiter verdichtet wird, weil dadurch Naherholungsflächen verschwinden. Damit möchte ich mich zukünftig verstärkt auseinandersetzen.
„Nachhaltigkeit in der Lehre“ – Broschüre und Tagung
Das 2011 gegründete Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität (KNU) hat die Aufgabe, die Universität Hamburg bei der Ausgestaltung als „University for a Sustainable Future“ strategisch und operativ zu unterstützen. In der Broschüre „Nachhaltigkeit in der Lehre – Perspektiven der Universität Hamburg“ werden insgesamt 35 Beispiele für Lehrangebote mit Nachhaltigkeitsbezug vorgestellt. Die Seminare und Vorlesungen wurden von den durchführenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst eingereicht. Ziel der Broschüre ist es, „einerseits exemplarisch sichtbar zu machen, was bereits alles zur Nachhaltigen Entwicklung an der Universität Hamburg im Bereich Studium und Lehre passiert.“ Zum anderen sollen Lehrende und Studierende der Universität Hamburg inspiriert werden „zu neuen Lehrveranstaltungsideen und neuen Kooperationen“. Die Broschüre ist Grundlage für eine universitätsinterne Tagung zum Thema „Gutes wahren, Neues wagen – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in der Lehre am 1. Juni. Die Tagung ist offen für alle am Thema interessierte Lehrende und Studierende.
Die Online-Version der Broschüre gibt es hier (PDF):
www.nachhaltige.uni-hamburg.de/downloads/2018/broschuere-nachhaltigkeit-in-der-lehre.pdf