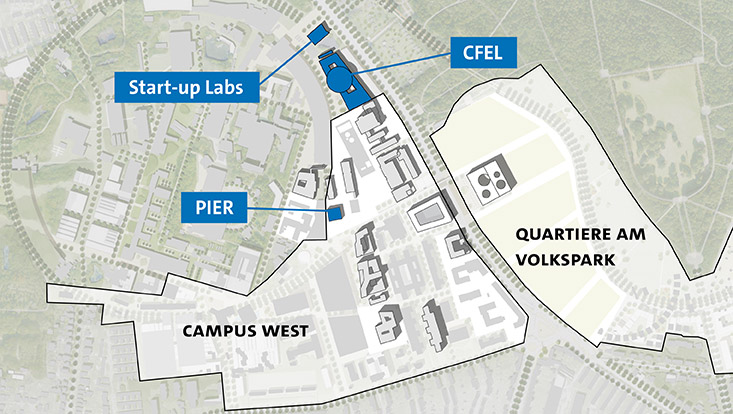„Dezidiert gegenwartsbezogen“Prof. Dr. Yavuz Köse zum Workshop „Türkeiforschung im deutschsprachigen Raum“
14. März 2018, von Anna Priebe

Foto: Gabor Ferencz
Die Turkologie hat in Hamburg eine lange Tradition. Am 16. und 17. März findet am TürkeiEuropaZentrum zum fünften Mal die Workshop-Reihe „Türkeiforschung im deutschsprachigen Raum“ statt – inklusive einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung zur akademischen Freiheit in der Türkei. Prof. Dr. Yavuz Köse, Professor für Turkologie, zu den Herausforderungen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Türkei in bewegten Zeiten.
Putsch, Deniz Yücel – die Türkei ist immer wieder in den Schlagzeilen. Inwiefern hat das Auswirkungen auf die Türkeiforschung?
Wir sind von den tagespolitischen Ereignissen natürlich nicht ganz frei. Mit dem TürkeiEuropa-Zentrum haben wir zudem eine Einrichtung, die sich dezidiert der gegenwartsbezogenen Türkeiforschung widmet. Das ist ein Bereich, der in Deutschland und auch in Europa eher in den Anfängen steckt. Das TürkeiEuropaZentrum arbeitet dabei interdisziplinär, das heißt unter Einbeziehung aller Einrichtungen und Disziplinen, die sich mit der Türkei befassen. Andererseits ist es natürlich auch immer etwas schwierig, sich an tagespolitischen Themen zu orientieren, weil wir es eher gewohnt sind, in langfristigen Konzepten zu denken – und wir sehen zum Beispiel an den Aussagen von politologisch arbeitenden Forschern, wie kurzfristig und auch wie falsch letztlich Einschätzungen sein können und wie sich in der Türkei tatsächlich von heute auf morgen alles ändern kann.
Ein Stück weit ist aber auch der anstehende Workshop von den aktuellen Ereignissen beeinflusst, weil er sich mit türkischen Umbrüchen, Krisen und Widerständen befasst – aber eben nicht nur mit gegenwärtigen, sondern auch mit historischen. Wir wollen uns diesem Phänomen in einem längeren Zeitverlauf widmen.
Welche Tradition hat die Türkeiforschung in Deutschland?
Die „türkischen Studien“ waren institutionell von Beginn an quasi eine Unterdisziplin der Orientalistik, später der Islamwissenschaften. Die Anfänge der akademischen Auseinandersetzung mit dem Orient, also der modernen Orientstudien, fallen an deutschen Universitäten in das erste Viertel des 19. Jahrhunderts. In Hamburg wird Türkisch bereits seit 1909 unterrichtet – damals noch am Hamburgischen Kolonialinstitut, einem Vorläufer der 1919 gegründeten Universität. Die frühe Turkologie war stark philologisch ausgerichtet, auch in Hamburg, hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten in gewisser Weise von dieser Tradition emanzipiert und widmet sich vor allem der Erforschung des Osmanischen Reiches und zunehmend auch der Geschichte und Kultur der Türkei.
Was ist das Ziel des Workshops?
Die Anfangsidee war die Verbesserung des Austausches junger Türkeiforscherinnen und -forscher; daraus sind auch schon gemeinsame Projekte entstanden. Wir wollten und wollen innerhalb des deutschsprachigen Raums die Forschung zur Türkei durch einen interdisziplinären Blick stärken, die gegenwartsorientierte, zeitgeschichtliche Türkeiforschung bündeln und Anreize schaffen, sich mit diesen Themen auch außerhalb der Turkologie zu befassen. Aber es ist durchaus so, dass die Teilnehmer nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum kommen, sondern auch aus anderen europäischen Ländern und der Türkei selbst.
Ein Oberthema der Workshops ist unter anderem „Kultur und Gesellschaft“. Welche Bedeutung hat Kunst aus wissenschaftlicher Sicht für die türkische Gesellschaft?
Das Rahmenthema ist ja „Umbrüche – Krisen – Widerstände“ – und es ist in der Tat so, dass solche Themen auch im kulturellen Kontext immer wieder thematisiert und reflektiert werden. Die Zielsetzung des diesjährigen Workshops ist, sich das genauer anzusehen – nicht nur, was jüngst mit dem Putschversuch in der Türkei losgetreten wurde, sondern auch die Verarbeitung ähnlicher Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Ein ganz wesentlicher kultureller Bereich, in dem sich Menschen mit diesen Erfahrungen und neuen Situationen auseinandergesetzt haben, ist die Literatur. Es ist insofern auch kein Zufall, dass an der Universität Hamburg als nahezu bundesweit einziger Einrichtung eine Juniorprofessur für türkische Literatur existiert.
Es ist ein spannendes Feld, sich anzusehen, wie im Bereich der Literatur, der bildenden Kunst, aber auch im Film und Theater solche Umbruchserfahrungen reflektiert werden. Ein vielleicht recht illustratives Beispiel sind die Gezi-Proteste, die 2013 ganz neue Formen künstlerisch-politischer Artikulationen generiert haben. Man denke zum Beispiel an die Graffitikunst wie den Pinguin mit Gasmaske, der wie der stehende Mann Duran Adam zum Symbol des Widerstands wurde. Sie zeigen, dass innerhalb der türkischen Gesellschaft eine Vielzahl von Möglichkeiten besteht, auf die Realitäten zu reagieren.
TürkeiEuropaZentrum
Das TürkeiEuropaZentrum feiert 2018 sein zehnjähriges Bestehen. Seit Beginn wird alle zwei Jahre die Workshop-Reihe „Türkeiforschung im deutschsprachigen Raum“ veranstaltet. In diesem Jahr ist die Veranstaltung – in Kooperation mit „Network Turkey“ und der Stiftung Mercator – dem Thema „Umbrüche – Krisen – Widerstände“ gewidmet. Am 16. März 2018 um 18.30 Uhr findet zudem eine öffentliche Diskussion statt (Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, Raum 221). Das Thema lautet „Academic Freedom in Turkey“. Die Ergebnisse des Workshops werden in der Publikationsreihe „Junge Perspektiven der Türkeiforschung“ veröffentlicht.
Mehr Informationen: www.uni-hamburg.de/tuerkeiforschung2018