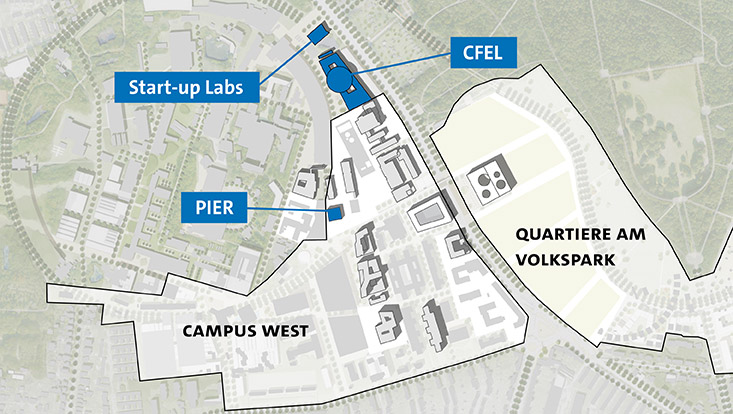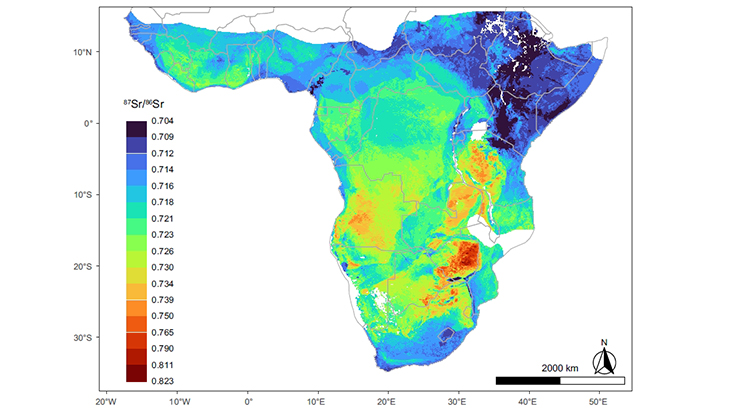Ist Spanien „anders“?Studientag zu Spaniens Nationalismus und Identität von der Antike bis heute
25. Juni 2018, von Anna Priebe

Foto: pixabay/Etereuti
Nationalismus und Identität sind Stichworte, die aktuell ganz Europa bewegen. Wie es sich in Spanien verhält und welche Rolle die Geschichte für den modernen Nationalismus spielt, untersucht der Studientag „‚Spain is different‘!? Nationalism and Identity between Antiquity and Today“ am 28. Juni. Ein Interview mit Organisatorin Prof. Dr. Sabine Panzram, Professorin für Alte Geschichte, an der Universität Hamburg über Identitätsfindung und die Instrumentalisierung von Geschichte.
Inwiefern beeinflussen aktuelle Ereignisse wie der Katalonien-Konflikt Ihre Forschung als Historikerin?
Sie beeinflussen meine Arbeit insofern, als dass ich mich frage, woher diese Konflikte rühren und ob ich in meinem Spezialgebiet, der Alten Geschichte, bereits Anzeichen dafür finden kann. Katalonien argumentiert zum Beispiel mit Bezugnahme auf eine eigene Sprache und eine eigene Literatur für seinen selbstständigen politischen Status – und erinnert auch immer wieder an die glorreiche Vergangenheit zu Zeiten des Imperium Romanum und im Mittelalter.
Gibt es denn Besonderheiten in der Geschichte Spaniens?
Was diese Region so interessant macht, ist die Tatsache, dass die Iberische Halbinsel seit frühester Zeit Ziel von Migrationen war. Das begann im ersten Jahrtausend vor Christus mit den Phönikern, ging über die Griechen zu den Römern bis zur sogenannten „Völkerwanderung“: unter anderen kamen Westgoten, Sueben, Alanen, dann die Araber und Berber. Das heißt, die „hispani“ waren eigentlich permanent damit beschäftigt, ihre eigene Identität zu finden, sich immer wieder gegenüber „den anderen“ zu definieren. Das ist etwas, das insbesondere in Spanien zu sehr intensiven Diskussionen der Identitäts- und Selbstfindung geführt hat.
Zudem fällt im Fall von Spanien besonders das Bestreben auf, die verschiedenen Epochen der spanischen Geschichte im politischen Diskurs zu instrumentalisieren. Als Historikerinnen und Historiker sind wir daher gefragt, diese „Verfälschungen“ offenzulegen. Ein Beispiel: Für Franco begann – zugespitzt formuliert – die Geschichte Spaniens im Jahre 589 nach Christus, mit dem 3. Konzil von Toledo, auf dem die Westgoten zum Katholizismus übertraten. Seitdem sei Spanien „eines, frei und katholisch“. Was vorher gewesen war – die iberische oder keltiberische Kultur etwa – interessierten ihn nicht.
Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt in der spanischen Geschichte?
Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der römischen Geschichte, also der Präsenz Roms in Spanien, das heißt, ich betrachte die Zeit vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum Jahre 711 nach Christus und der sogenannten Invasion der Umayyaden auf der Iberischen Halbinsel.
Welche Aspekte werden beim Studientag noch im Vordergrund stehen?
Uns schien es besonders interessant, uns mit allen Epochen der Geschichte auseinanderzusetzen und aus der Sicht verschiedener Disziplinen – den Geschichtswissenschaften, aber auch der Rechts- und Kunstgeschichte oder der Hispanistik. Wir wollen uns einerseits mit der Rolle beschäftigen, die die Antike im nationalistischen Diskurs heute einnimmt, aber genauso mit der Frage, welche Bedeutung al-Andalus – die Zeit im Mittelalter, in der große Bereiche der Iberischen Halbinsel unter arabischer Herrschaft standen – heute hat. Da wäre z. B. ein interessanter Aspekt, dass gerade seit „9/11“ in Spanien versucht wird, diese Zeit zu ignorieren oder sogar zu negieren.
Nationalismus ist nicht spezifisch für Spanien. Werden die Ergebnisse des Tages auch auf andere europäische Länder übertragen werden?
Ganz konkret werden wir uns „nur“ mit Spanien beschäftigen, aber wir gehen davon aus, dass man die Ergebnisse der Fallstudie – wie wir diesen Studientag zum Verhältnis von Nationalismus und Identität verstehen –, auch mit anderen Ländern vergleichen könnte.
Diese müssten strukturell vergleichbar sein, es müsste sich also um Länder handeln, die bis vor 20 oder 30 Jahren diktatorisch regiert wurden und nach einer gewissen Phase des Übergangs jetzt eine demokratische Verfassung haben. Ich denke da zum Beispiel an Länder des ehemaligen Ostblocks.
Studientag
Zu der Veranstaltung, die im Vortragssaal der Staats- und Universitätsbibliothek stattfindet, werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Spanien, Frankreich, England und Deutschland erwartet. Veranstaltungssprache ist Englisch. Prof. Dr. Sabine Panzram organisiert den Studientag gemeinsam mit Prof. Dr. Alejandro García Sanjuán, Professor für Mittelalterliche Geschichte von der Universidad de Huelva und momentan Gastprofessor an der Universität Hamburg. Der Studientag, der für alle Interessierten offen ist, ist Teil der Aktivitäten von „Toletum – Netzwerk zur Erforschung der Iberischen Halbinsel in der Antike“. Mehr Informationen und Programm: www.toletum-network.com